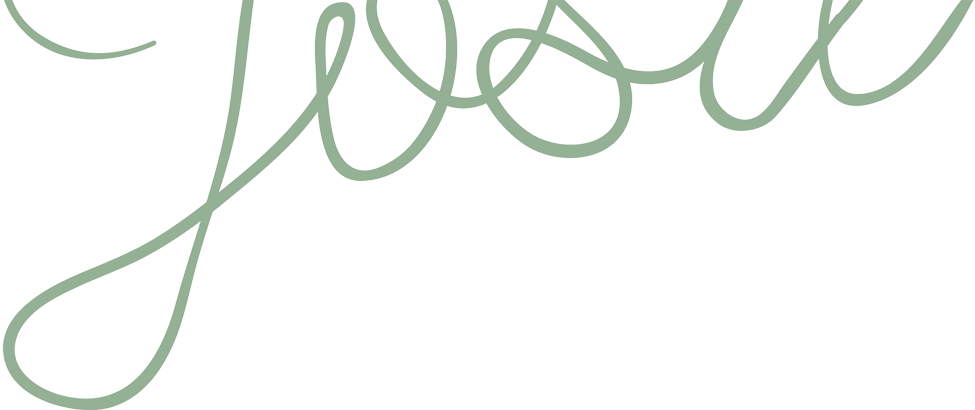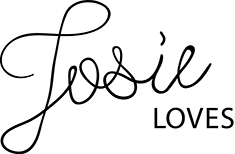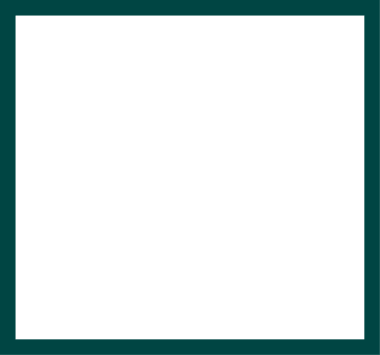Als dies hier noch ein „klassischer“ Modeblog war, schrieb ich des Öfteren über meine ganz persönlichen Erfahrungen mit der Modebranche. Von vielen positiven, aber auch einigen sehr negativen. An eine davon wurde ich letzte Woche erinnert und freute mich, dass seit meiner damaligen negativen Erfahrung tatsächlich viel Positives passiert ist. Und darüber möchte ich heute schreiben.
Als ich damals mit dem Bloggen begann, schwappten die Blogs gerade erst aus den USA nach Deutschland über und Josie loves war einer der ersten deutschen Modeblogs. Mein damaliger Beweggrund für einen eigenen Blog, nachdem ich bereits zwei Jahre Online-Erfahrung hatte und für Blogs von Online-Shops sowie Onlinemagazine schrieb: Als freie Moderedakteurin wollte ich unbedingt eine Plattform, auf der ich frei Schnauze über all die (Mode)Themen schreiben konnte, die ich spannend fand. Die mich bewegten. Schnell wurde damals klar: Als Modebloggerin geht es nicht nur ums „Schreiben“, sondern auch ums „Zeigen“. Genauer gesagt um das „sich selbst zeigen“. Und so entstanden sie, die ersten Outfitposts (Ein paar davon seht ihr hier im Überblick!). Was ich damals am Modebloggen so liebte: Bloggerinnen und Blogger zeigten Mode im „echten Leben“, machten sie nahbarer und schafften die Verbindung von den auf dem Runway gezeigten Looks zum „Mädchen von Nebenan“. Letztendlich waren meine Kolleginnen und ich ja selbst diese „Mädchen von Nebenan“, und genau das machte das Modebloggen so authentisch. Modeblogger*innen zeigten, dass es eben nicht nur Size Zero gibt, sondern so viele verschiedene Körpertypen. Dass „schön“ mehr als nur einen Blond-groß-dünn-Stereotyp beschreibt.
Josie loves wurde schnell bekannt, ich wurde zu Events eingeladen und durfte mit vielen meiner Lieblingsmarken zusammenarbeiten. Fun Fact am Rande: „Zusammenarbeiten“ bedeutete in den ersten Jahren oftmals nicht, dass man dafür bezahlt wurde. Der Weg von den kostenlosen Schuhen zur echten Bezahlung war teilweise ein harter Kampf. Dass Firmen heutzutage oftmals Unsummen für Influencer-Kooperationen ausgeben bedurfte unzählige Preis-Diskussionen der Modeblogger*innen und war eine jahrelange Entwicklung.
Je mehr ich mit den wirklich großen Marken zusammenarbeitete, desto mehr fand ich mich in der ursprünglichen Problematik der Modebranche wieder: fehlende Repräsentation von unterschiedlichen Körpertypen. Samples gab es ausschließlich in XS und S, bei den Luxusmarken bekam man genau die Stücke, die auf dem Runway an Models in Size Zero gezeigt wurden. Passte ich mit meiner Größe 38 nicht in diese Stücke war nicht die Marke das Problem, sondern mein Körper. Das wurde mir nicht selten vermittelt. Und ja, das machte damals etwas mit mir.
Weshalb ich heute darüber schreibe? Vor ein paar Tagen postete ich auf Instagram ein paar Bilder aus dem Jahr 2013 und schrieb darüber, wie sehr sich der Stil in zehn Jahren doch änderte. Da ich zu einem dieser Bilder besonders viele Nachrichten bekam und so viele von euch an Blair Waldorf und Gossip Girl erinnert wurden, ging ich am Tag danach noch einmal näher auf den Hintergrund des Bildes ein und zeigte mehr Impressionen von dieser Fotoproduktion.


Ich konnte mein Glück nicht fassen, dass ich im Rahmen der Paris Fashion Week ein großes Shooting mit meiner damals allerliebsten Lieblingsmarke Louis Vuitton umsetzen durfte. Für mich so ein großer und besonderer Moment und sicherlich eines der Highlights dieser Zeit.
Doch es gibt auch einen negativen Beigeschmack, an den ich jedes Mal denken muss, wenn ich diese Bilder sehe. Nicht nur ich, sondern sogar meine Freundin, die mir zehn Jahre später dazu schrieb, da ihr die Situation im Gedächtnis geblieben war.


Obwohl man mich kannte und dieses Shooting nur mit mir umgesetzt wurde, bekam ich am Vorabend alles in Size Zero ins Hotelzimmer geliefert. Es stand schlicht und einfach nicht zur Debatte, dass ich in eine Mini-Hose oder einen figurbetonten Rock nicht reinpassen könnte. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich in Tränen ausgebrochen bin und den Fehler bei mir suchte. Letztendlich pickte ich mir die Stücke aus, die mir passten und es entstanden Bilder, die nichts von dem Drama am Vorabend erahnen ließen. Geplant waren sieben Looks und schlussendlich hatte ich auf allen Bildern den gleichen, ausgestellten Rock an, da mir kein anderes Unterteil auch nur annähernd passte. Kurz darauf entstand auch die Kolumne „Schöne, kranke Modewelt„, die bis heute zu den meistgelesenen auf Josie loves zählt.
Weshalb ich mich dafür entschieden habe, heute über dieses Erlebnis aus dem Herbst 2013 zu schreiben? Weil ich endlich – und hier kommen wir zur positiven Wendung- das Gefühl habe, dass sich WIRKLICH etwas ändert. Dass „Diversity“ in der Modebranche nicht mehr nur ein Wunschdenken ist, sondern in den vergangenen Jahren etwas Wichtiges, Großes angestoßen wurde. Langsam, aber sicher passiert die Wende. Auch wenn wir noch lange nicht da sind, wo wir wirklich hinmüssen. Es ist nicht mehr die viel umjubelte Ausnahme, wenn ein Model mit Größen jenseits der 32 über den Runway läuft, sondern es fällt vielmehr als negative Ausnahme auf, wenn der gesamte Model-Cast nur Size Zero trägt. Das ist so wichtig. Insbesondere für junge Mädchen. Wir sind alle unterschiedlich und das ist gut so. Und es ist so relevant, dass das auch repräsentiert wird, dass es Identifikationsfiguren gibt.
Und hier spreche ich natürlich nicht nur von der Modebranche und Frauenkörpern. Sondern von allen Bereichen, in denen wir als Menschen uns unterscheiden. Hautfarbe, Körpertypen, die sexuelle Orientierung. Erst kürzlich hörte ich den (sehr empfehlenswerten!) neuen Podcast von Riccardo Simonetti und Anke Engelke „Quality Time„, in dem genau dieses Thema in der Pilotfolge sehr lange besprochen wurde. Generell finde ich die Arbeit von Riccardo so, so wertvoll und es freut mich von Herzen, dass er seit ein paar Jahren diese große Bühne bekommt, um seine Message „Sei du selbst!“ zu verbreiten. Im Podcast spricht er unter anderem darüber, wie schwierig es für ihn war, sich als junger, schwuler Mann in Filmen und Serien nicht repräsentiert zu sehen. Dass es vermuten ließ, dass es vielleicht gar kein Happy End gebe, wenn man „anders tickt als die Mehrheit der Gesellschaft“. Mich macht es so traurig auch nur daran zu denken, dass es ihm und so vielen anderen jungen Menschen so ging. Und ich kann nur hoffen, dass seine Arbeit und die immer größer werdende mediale Präsenz der queeren Community – auch in besagten Filmen und Serien – bewirkt, dass es immer weniger jungen Menschen so geht und unsere Gesellschaft endlich toleranter wird.
Lasst uns als Gesellschaft endlich aufhören, Menschen in Schubladen zu stecken und zu bewerten. Lasst uns um Himmels Willen aufhören festzulegen, was normal ist und was nicht. Wir Menschen sind bunt und es gibt unzählige verschiedene Nuancen des Menschseins. Unsere Optik variiert, unsere Charaktere unterscheiden sich. Und das ist gut so!
PS: Lasst uns im Jahr 2033 noch einmal sprechen. Ich bin unendlich gespannt, ob aus dem „langsam, aber sicher“ ein „Na selbstverständlich!“ geworden ist.